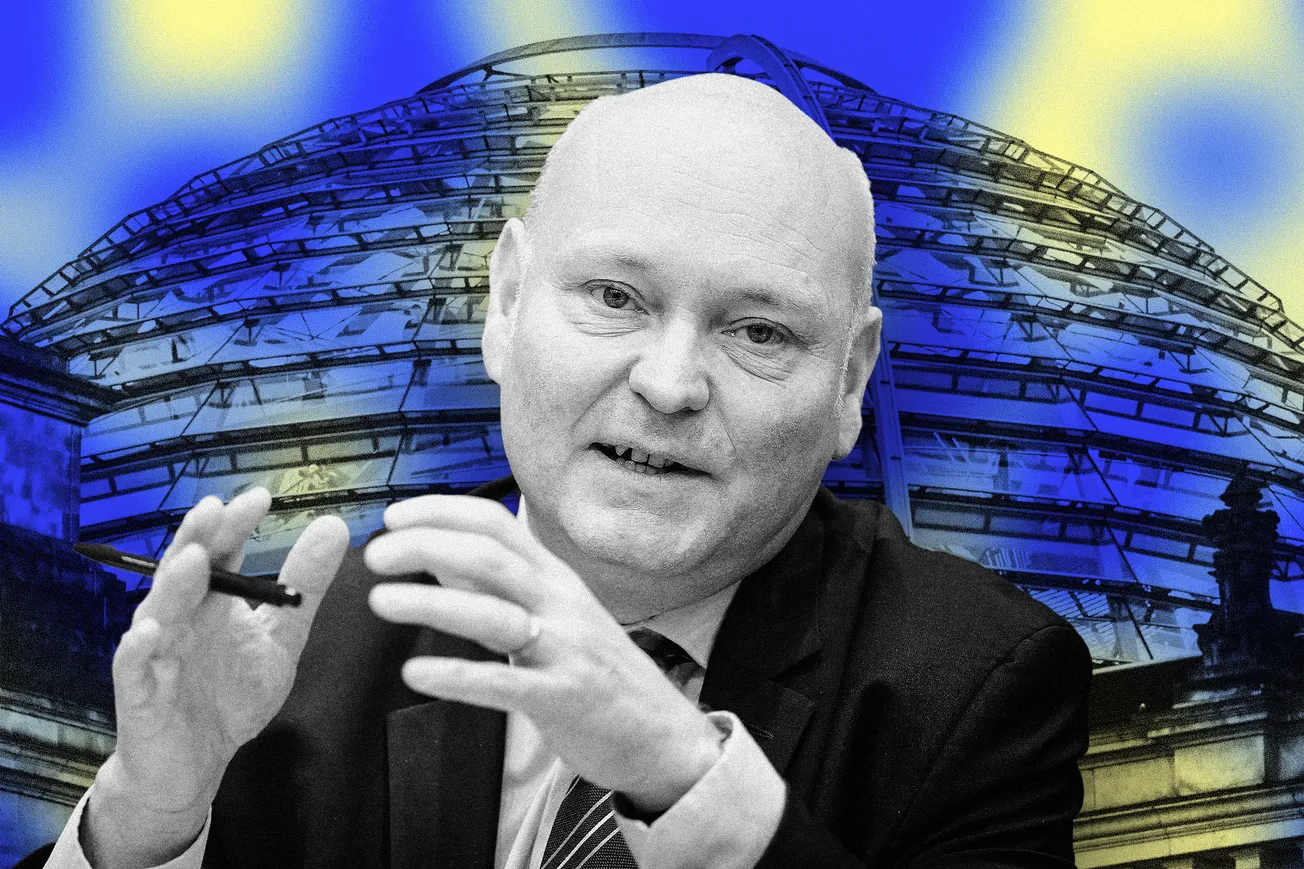Das Stichwort »CumEx« löst Frust und Wut aus. Zurecht – immerhin wird der Schaden aus CumEx-Geschäften auf rund 10 Milliarden Euro geschätzt. Umso lauter erscheint hingegen die Stille, die bei der Aufklärung der CumCum-Geschäfte zu vernehmen ist. Geschätzter Schaden: 28,5 Milliarden Euro!
Der neue Report von Finanzwende Recherche zeigt, dass dieser Skandal nach wie vor nicht aufgeklärt ist. Laut Bundesfinanzministerium wurden bis Ende 2023 erst 200 Millionen Euro der illegalen Profite dieser sogenannten Tax Trades rechtskräftig zurückgefordert. Das entspricht nicht einmal einem Prozent des geschätzten Schadens. Und nicht nur finanziell steht die Aufarbeitung erst am Anfang: Auch dazu, welche einzelnen Institute beteiligt sind, gibt es kaum Transparenz. Dabei ist inzwischen bekannt, dass sich selbst Sparkassen – obwohl sie gesetzlich der Gemeinwohlorientierung verpflichtet sind – an den illegalen Geschäften beteiligt haben. Doch das genaue Ausmaß bleibt im Dunkeln, wie die Auswertung von öffentlich zugänglichen Informationen sowie Landtags- und Bundestagsanfragen und die Antworten der Sparkassenverbände an Finanzwende Recherche zeigen.
Schleppende Aufklärung
CumEx und CumCum sind eng miteinander verwandt. Während sich Finanzinvestoren bei CumEx-Geschäften die Kapitalertragsteuer mehrfach erstatten lassen, obwohl sie zuvor nur einmal abgeführt worden war, vermeiden sie bei CumCum-Geschäften die eigentlich fällige Kapitalertragsteuer von Beginn an. Hierfür wird in den meisten CumCum-Varianten ausgenutzt, dass viele inländische Finanzinstitute sich die auf Dividenden anfallende Kapitalertragsteuer zurückerstatten lassen können. Also übertragen ausländische Institute ihre deutschen Aktienpakete kurzfristig an inländische Finanzinstitute, die sich die Steuer erstatten lassen und die Erstattung mit ihren ausländischen Partnern teilen. Banken, Fonds und Versicherungen verbinden diese beiden Strategien – weit verbreitete Tax Trades allein zum Nachteil öffentlicher Kassen – in der Praxis häufig miteinander. Kronzeugen sprachen vor Gericht deswegen von einer »Industrie«.
Die Finanzbranche hat sich so über Jahre hinweg an der Staatskasse bereichert – auf Kosten aller Steuerzahlenden. Gerade in Zeiten, in denen Wörter wie »Haushaltslücke« und »Neuverschuldung« überall zu hören sind, sollte endlich darüber gesprochen werden, dass immer noch ein sehr lückenhaftes Bild im Hinblick auf den Schadensumfang herrscht und bisher nur ein Bruchteil der illegal erlangten Profite vom Staat zurückgefordert wurde.
Kürzlich berichtete das Handelsblatt, dass sich erstmals fünf Banker wegen CumCum-Geschäften vor Gericht verantworten müssen. Das ist ein wichtiger Schritt. Zu lange hielt sich das Narrativ, CumCum sei legal und keinesfalls strafbar. Aber: Wer das Finanzamt täuscht, macht sich wegen Steuerhinterziehung strafbar, unabhängig davon, ob man über CumEx oder CumCum täuscht.
Die Rolle der Sparkassen: Gemeinwohlorientierte Diebe?
Der Umstand, dass sich selbst Sparkassen an diesen illegalen Geschäften beteiligt haben, ist vor allem deshalb bemerkenswert, da diese laut Gesetz dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Ihre Gewinne sollen nicht maximiert, sondern beispielsweise in die Region investiert werden. Deswegen befinden sie sich meist in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Kommunalpolitikerinnen und -politiker sitzen häufig im Verwaltungsrat und kontrollieren die Geschäfte, die Länder üben die Rechtsaufsicht aus. Trotzdem haben sich Sparkassen an den illegalen CumCum-Geschäften beteiligt, häufig mittels sogenannter strukturierter Wertpapierleihen, auch weitergeleitetes CumCum genannt. Bei diesen zweischrittigen Geschäften nutzte das deutsche Finanzinstitut, nachdem es die Aktien vom ausländischen Finanzinstitut erhalten hatte, nur einen Teil dieser Aktien für eigene Steueranrechnungen beziehungsweise -erstattungen. Die übrigen Aktien gab es an kleinere inländische Kreditinstitute oder Unternehmen weiter, die dann ihrerseits CumCum-Anrechnungen beziehungsweise -erstattungen vornahmen.
Es wurde zum Beispiel in den Badischen Neuen Nachrichten berichtet, dass sich die Sparkasse Karlsruhe über 27 Millionen Euro Kapitalertragsteuer durch weitergeleitete CumCum-Geschäfte erstatten ließ. Der Verwaltungsratsvorsitzende und SPD-Oberbürgermeister von Karlsruhe, Frank Mentrup, verteidigt die Sparkasse Karlsruhe in einem Interview damit, dass diese Geschäfte »in Deutschland üblich« gewesen seien und man zunächst »abschließend auf dem Rechtsweg« klären müsse, »wer letztlich diese Steuervorauszahlungen für sich nutzen« könne. Diese Haltung ist in doppelter Hinsicht erstaunlich: Zum einen sind mittlerweile mehrere Urteile zu CumCum und weitergeleitetem CumCum ergangen, sodass die Rechtslage mitnichten unklar ist. Das Bundesfinanzministerium hat die Rechtslage deswegen auch in einem sogenannten BMF-Schreiben zusammengefasst und damit die Finanzverwaltung zu einem einheitlichen Vorgehen verpflichtet. Zum anderen sind Tax Trades eindeutig nicht mit der Gemeinwohlorientierung der Sparkassen in Einklang zu bringen.
Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:
Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login