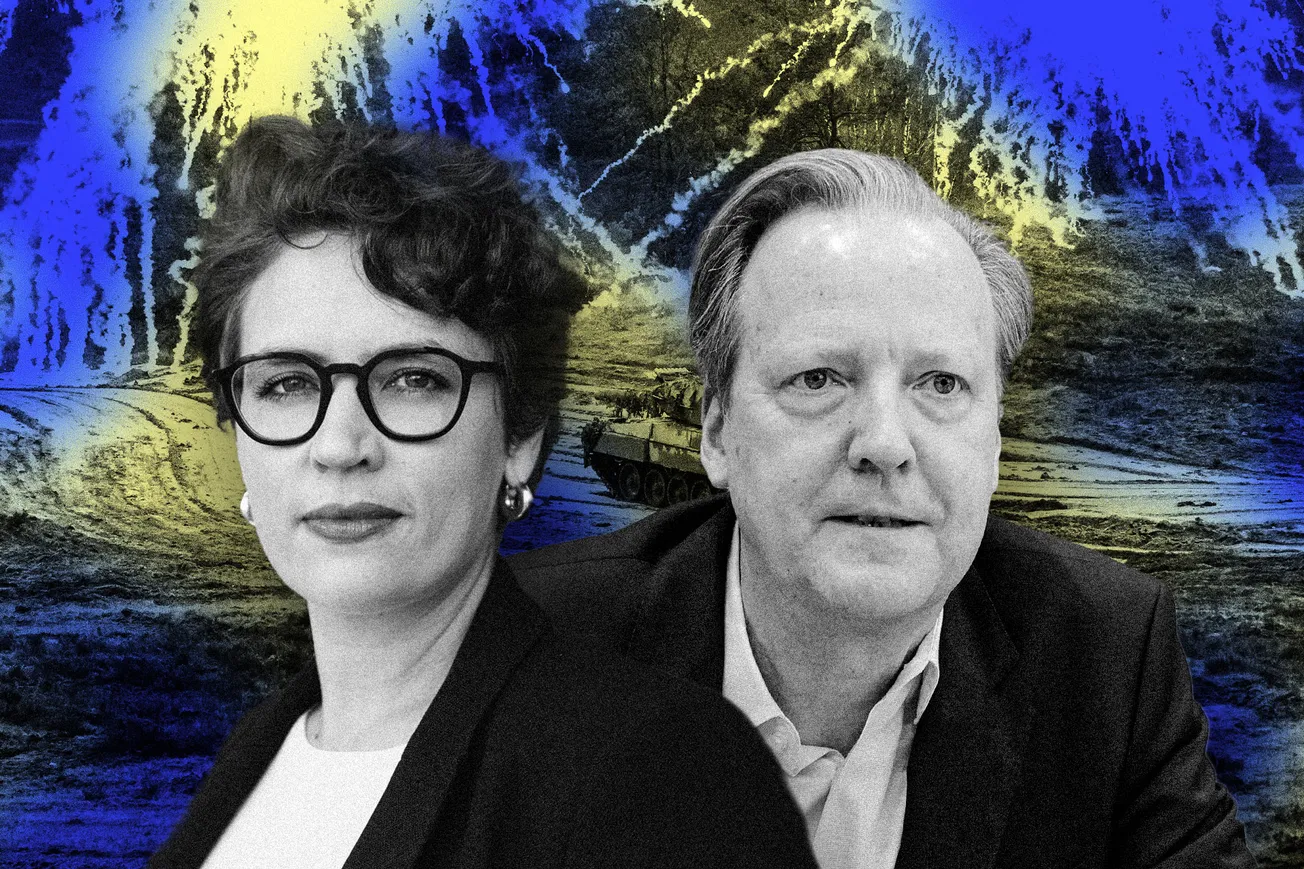Ein grauer Vormittag in Duisburg-Hochfeld. In einem Park neben der Schnellstraße, gegenüber der Poco Domäne, steht eine Gruppe junger Männer. Der eine führt einen Dobermann an der Leine. Der andere lässt einen Joint rumgehen. Selbst für das Ruhrgebiet ist dieser Park trostlos. »Ich habe doppelt AfD gewählt«, sagt der junge Mann mit dem Joint. Er ist 26 Jahre alt und will seinen Namen nicht verraten. Wegen der Polizei. »Verstehst schon.« Obwohl er selbst 2014 aus Syrien nach Deutschland kam, geht ihm die »unkontrollierte« Einwanderung gegen den Strich. Besonders die Bulgaren und Rumänen, die seit 2014 vermehrt nach Duisburg ziehen, sieht er als Problem. Auch sein Kollege würde, wenn er könnte, AfD wählen, wegen der hohen Energiepreise. 240 Euro zahle er pro Monat. Was ihnen in Duisburg gefalle? »Nix«, sagt der Mann mit dem Dobermann. Die anderen stimmen ein. »Ellbogengesellschaft ist das hier«, sagt der AfD-Wähler.
Mit ihrem Frust sind die Männer in Duisburg nicht allein. Mit ihrer Wahlentscheidung auch nicht. In Bezirken wie Hochfeld, Marxloh oder Neumühl holte die AfD bei der Bundestagswahl Spitzenergebnisse von bis zu 36 Prozent und schrammte im Norden der Stadt nur haarscharf an einem Direktmandat vorbei. Die rechten Wahlergebnisse sind auch die Folge eines langen wirtschaftlichen Abstiegs der Region. Denn Deutschlands ehemaligem industriellen Kraftort gehen die Jobs aus. 2018 schloss die letzte Zeche in Bottrop und jetzt schwächelt auch die Stahlindustrie: ThyssenKrupp kündigte an, in Duisburg tausende Stellen abbauen zu wollen. Ein Ausflug nach Duisburg zeigt auf engstem Raum all jene Probleme, deren Lösungen für ganz Deutschland entscheidend sind. Ganz unten kämpfen sie alle gegeneinander, anstatt sich gemeinsam für Verbesserungen einzusetzen – und die Politik befeuert diesen Kampf, statt entgegenzusteuern.
Die Krise in der Stahlindustrie
Wer nie AfD wählen würde, ist Mirze Edis. Als der die Füße unter den Tisch seines Vaters stellte, sagt der – wie immer beim Abendbrot –, dass es mit dem Stahl zu Ende geht. Wie die Jungs aus dem Park hat auch Edis eine Migrationsgeschichte. Sein Vater kam 1975 von Anatolien nach Duisburg, um bei Thyssen zu arbeiten. Er wächst in Hochfeld auf, umgeben von Trinkhallen, Taubenzüchtern und dem Kegelverein. Als Edis 14 Jahre alt wird, sagt ihm sein Vater, dass er bei Thyssen anzufangen hat – genauer bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM), heute Tochtergesellschaft von ThyssenKrupp. Obwohl Edis Zweifel hat, beginnt er direkt nach der zehnten Klasse die Ausbildung, wie so viele hier. »In den 70er Jahren kann ich mich nicht daran erinnern, dass es einen einzigen Arbeitslosen gab.« Heute ist Edis 53 Jahre alt und seine Welt ist eine andere. Die Arbeitslosenquote in Duisburg liegt im März 2025 bei 13,4 Prozent. Das ist eine der höchsten Quoten im Ruhrgebiet, nur übertroffen von Gelsenkirchen. Das Stahlgeschäft in Deutschland ist unsicher geworden. Gründe dafür sind die hohen Energiekosten, die schwache Nachfrage und die Konkurrenz aus Asien. Die Rohstahlproduktion in Deutschland sank 2023 auf 35,4 Millionen Tonnen, der niedrigste Wert seit der Finanzkrise 2009. Edis will gegen diese Entwicklung ankämpfen. Er arbeitet immer noch für die HKM, mittlerweile aber als freigestelltes Betriebsratsmitglied. Außerdem ist er für seine Partei Die Linke in den Bundestag gewählt worden.
Während Edis sich politisch engagiert, scheint für andere Widerstand nur noch an der Wahlurne möglich zu sein. Conrad Ziller ist Professor am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Wie erklärt er es sich, dass eine Gruppe junger Menschen mit Migrationshintergrund die AfD wählt? »Die hohe Arbeitslosigkeit ist eines der zentralen Probleme der Stadt, die weiterhin durch die Transformation zur Dienstleistungsgesellschaft bestimmt ist.« Gerade die ehemaligen Arbeiterviertel im Norden der Stadt haben sich zu benachteiligten Quartieren entwickelt. Hohe Arbeitslosigkeit und geringes Einkommen treffen dort auf niedrige Bildung und einen migrantischen Anteil in der Bevölkerung. Daraus entstehe Frust und ein Gefühl des Abgehängtseins. Eigentlich müssten die ehemaligen Arbeiterinnen und Arbeiter des Duisburger Nordens aus Eigeninteresse eine Umverteilungspartei wählen, wie die SPD oder die Linke, vielleicht auch das BSW, sagt Ziller. Sie müssen zusehen, dass sie mehr Netto vom Brutto haben, um vielleicht ein Stück weit in der sozialen Hierarchie aufsteigen können. Warum machen sie es nicht? »Der Zuwachs an Verbesserung durch eine mögliche linke Regierung ist aus Sicht vieler Betroffener zu gering«, sagt Ziller.
In Hochfeld ließ es sich leben
Das kann Edis bestätigen. An Hochfeld hat er gute Erinnerungen. Im Bezirk besaßen Thyssen und Siemens viele betriebseigene Wohnungen für die Arbeiterinnen. Und obwohl der Bezirk nicht wohlhabend war, gab es für Jugendliche ein Angebot. »Ich hatte mit den ganzen sozialen Einrichtungen, die es in Hochfeld gab, gar nicht die Möglichkeit, auf der schiefen Bahnen zu landen«, sagt Edis. Es gab ein Schwimmbad, fünf oder sechs Jugendzentren und eine Stadtteilbibliothek. Im Gegensatz zu heute, war man als Sohn einer Einwandererfamilie im Ort noch eingebunden. Edis hatte zudem immer einen festen Job, der es ihm ermöglichte, sich politisch einzubringen. Einer Studie der Otto Brenner Stiftung zufolge hat die Erfahrung von Mitbestimmung am Arbeitsplatz das Potenzial, die politischen Einstellungen von Beschäftigten zu beeinflussen. Beschäftigte, die sich eingebunden fühlen, haben mehr Vertrauen in demokratische Prozesse und wählen seltener rechts. Doch wenn überall die Abstiegsangst lauert, dürfte auch dieser Effekt schwächer werden. Die sozialen Einrichtungen, die Edis beschreibt, scheint es heute auch nicht mehr zu geben. Wer heute durch Hochfeld läuft, hat schon Schwierigkeiten damit, ein Mittagessen zu finden. Von einem Jugendzentrum ganz zu schweigen.
Zum Glück gibt es noch Mevlana, einen der letzten Dönerläden im Ort, der seine Fleischspieße noch selbst macht. Trotz Fasten ist Osman Kuzuoglu bester Stimmung. Der 26-Jährige ist der älteste von vier Söhnen und hilft neben dem Studium im Restaurant seiner Eltern. An der Wand hängen Familienfotos. Eines von seinem Vater bei der Eröffnung des Ladens 1987. Auf dem anderen Bild ist Großvater und Namensvetter Osman Kuzuoglu, der aus der Türkei nach Deutschland kam, um in einer Kartonfabrik zu arbeiten. »Damals gab es keine türkischen Restaurants in der Gegend«, erzählt Kuzuoglu. So kam sein Vater auf die Idee, das Lokal zu eröffnen. Angst davor, dass der Laden nicht laufen würde, hatte er nicht. »Im schlimmsten Fall essen wir alleine«. Der Laden wurde ein Erfolg. Wie geht es den vier Brüdern heute in Hochfeld? Viele Leute seien weggezogen, erzählen sie, vor allem andere türkische Familien. »Früher war alles voller Türken«, stimmt Kuzuoglus jüngerer Bruder zu. Dafür seien viele Rumänen und Bulgaren eingezogen. Gegenüber vom Laden haben einige Familien gewohnt, erzählt Kuzuoglu. Probleme mit denen hätte er nicht gehabt. Aber der Müll sei ein Problem gewesen. Vor ihrer Tür vollzieht sich ein Generationenwechsel. Die erste Welle zugezogener, meist männlicher Arbeiter aus der Türkei wird durch eine neue ersetzt, die es allem Anschein nach noch schwerer hat als die erste.