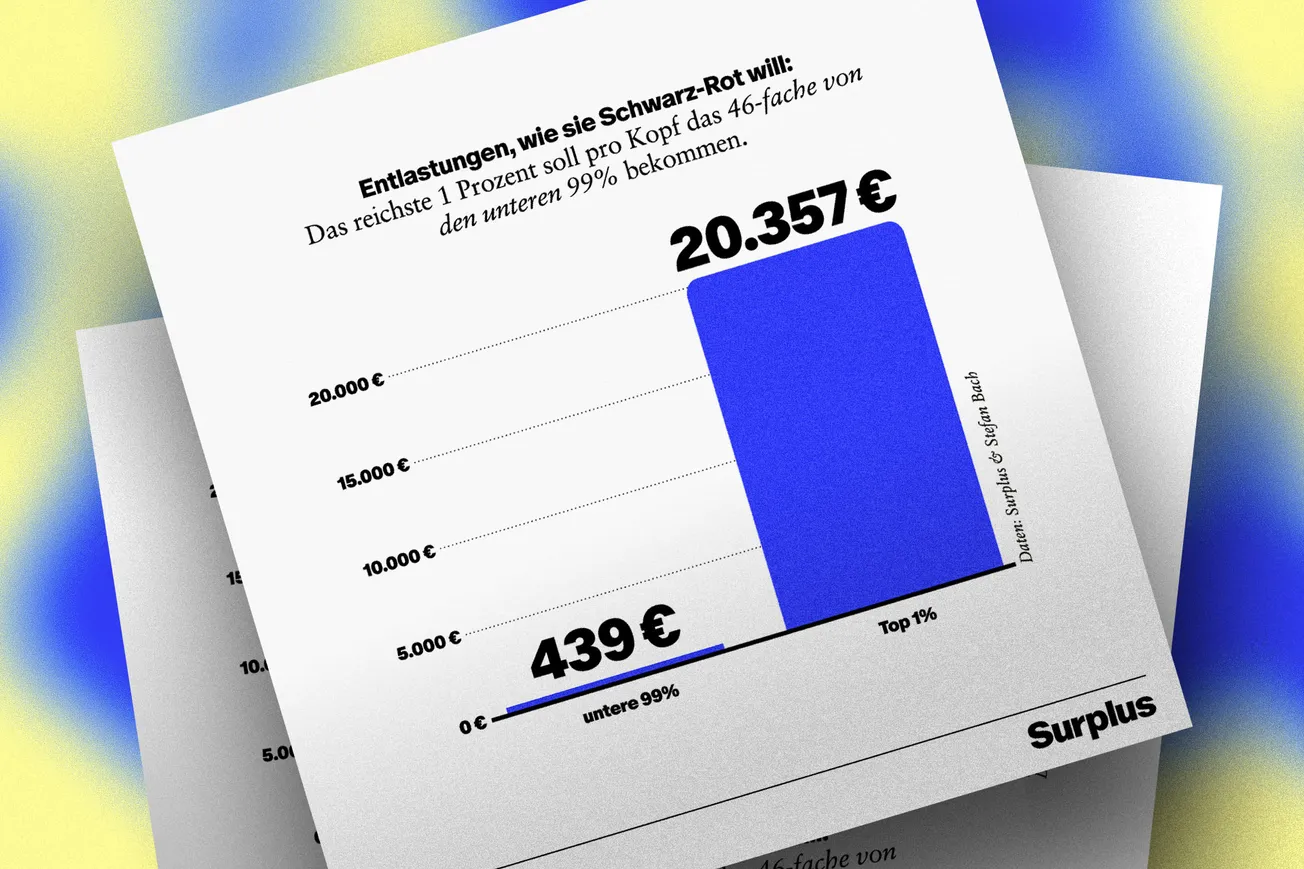Über politische Lager hinweg ist die Diagnose klar: Deutschland steckt in einer Wirtschaftskrise. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stagniert auf dem Niveau von 2019 und die schmerzhaften Kaufkraftverluste durch die Inflation sind noch nicht wieder aufgeholt worden. Hinzu kommt die veränderte internationale Situation seit 2021, die frühere Gewissheiten fundamental in Frage stellt. Trumps »America First«-Politik, Putins Krieg in der Ukraine und Chinas fulminantes Wachstum stellen die Wirtschafts-, Energie- und Sicherheitspolitik vor große Herausforderungen.
Wie wollen die Parteien in diesem Umfeld das Wachstum wieder ankurbeln? Kein Wahlprogramm überlebt die ersten Verhandlungen, aber sie lassen eine grobe Tendenz erkennen. Gerade weil sie Wunschzettel sind, drücken sie den Willen der Parteien klar wie sonst selten aus. Die Analyse zeigt: Von wegen »Mitte« gegen »Populisten« – in der Wirtschaftspolitik ist ein klassischer Lagerwahlkampf Links gegen Rechts im Gange. Damit wird diese Bundestagswahl auch zu einer Richtungsentscheidung zwischen Exportismus und Binnenmarkt.
Deutschland, dein Wachstum
Alle kapitalistischen Staaten müssen wachsen, das legitimiert sie auch politisch, aber sie erreichen dieses Wachstum auf verschiedenen Wegen. In der internationalen politischen Ökonomie wurde dafür das Konzept des »Wachstumsmodells« geprägt. Demnach ist das Wachstum in der letzten Instanz von der Nachfrage bestimmt. Ohne Umsatz kein Wachstum, so die bestechend einfache Grundidee. Anhand der wichtigsten Bestandteile der Nachfrage – dem privaten Konsum, den Staatsausgaben und den Exporten – können die Wachstumsmodelle abgeleitet werden.
Da Wachstumsmodelle über Handels- und Finanzströme voneinander abhängig sind, funktionieren Exportmodelle wie in Deutschland nur dann, wenn es auf der Gegenseite Konsummodelle wie in den USA gibt. Zu hohe Ungleichgewichte fördern globale Instabilität. Die entsprechenden Warnungen hat Deutschland bisher ignoriert.
Das deutsche, exportorientierte Wachstumsmodell ist bemerkenswert beständig und lässt sich in seinen Grundzügen bis in die Kaiserzeit zurückverfolgen. Nach der nationalsozialistischen »Ökonomie der Zerstörung«, die auf Autarkie und gewaltsame Ausbeutung setzte, wurde die junge Bundesrepublik von Anfang an durch die Weltmarktorientierung geprägt.
Für den Erfolg der Exportindustrie war es entscheidend, das heimische Preisniveau niedrig zu halten, indem man das Wachstum der Löhne und der Staatsausgaben möglichst zügelte. Der externen Abwertung der Deutschen Mark war im Nachkriegssystem fester Wechselkurse enge Grenzen gesetzt. Ähnliches gilt für den Euro als gemeinsame Währung mehrerer Staaten. Die Strategie der »internen Abwertung« verschaffte langfristige Wettbewerbsvorteile auf Kosten der arbeitenden Menschen und des Auslands.
Damit wurde von den Gründervätern der BRD ein Kreislauf etabliert, in dem das Wachstum davon abhängig gemacht wurde, dass deutsche Firmen im Ausland ordentliche Profite erwirtschaften und diese zuhause reinvestieren. Ludwig Erhard brachte das 1953 auf den Punkt, als er den Außenhandel als »den Kern und sogar die Voraussetzung unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung« beschrieb. Das Problem: Seit spätestens den 90er Jahren besteht dieser Zusammenhang nicht mehr, da weder Unternehmen noch der Staat nennenswert in heimisches Sachkapital und Infrastruktur investiert haben.
Ist ein solches Wachstumsmodell erst einmal etabliert, wird es zur »Normalität« und ist schwer zu verdrängen. Krisensituationen wie heute sind Zeiträume, in denen das Vertraute wieder zweifelhaft wird, neue Wege gesucht werden und Entscheidungen über die künftige Richtung getroffen werden müssen. Die Geschichte lehrt, dass die BRD bereits zweimal in solchen Krisen – in den 70ern und um die Jahrtausendwende – die Entscheidung traf, das bestehende Modell zu vertiefen. Die »interne Abwertung« wurde damit so auf die Spitze getrieben, dass Deutschland noch vor China die höchsten Exportquoten und Leistungsbilanzüberschüsse der Welt erzielt.
Jüngste Entwicklungen
Doch im Gegensatz zu früheren Situationen gibt es immer weniger Nachfrage aus dem In- und Ausland. Dafür gibt es drei wesentliche Gründe. Erstens löste der russische Angriffskrieg in der Ukraine einen Energiepreisschock aus, der sich in Preissteigerungen deutscher Güter niederschlug. Das Preisniveau wuchs zwischen 2022 und 2024 um insgesamt 15 Prozent. Das belastete den Konsum zuhause sowie den Absatz auf den Weltmärkten. Dieses Mal stand jedoch vor allem China ganz anders da als noch nach 2008, als es Deutschland mit großer Nachfrage aus Konjunkturprogrammen aus der Rezession zog, was uns zum zweiten Grund bringt.
Dank staatlich forcierter Industriepolitik hat sich China vom Absatzmarkt deutscher Technologie zum direkten Konkurrenten im Automobil-, Maschinen- und Anlagenbau entwickelt. Aufgrund der technologischen Aufholjagd, staatlicher Förderung und enormen Skalenerträgen können chinesische Unternehmen konkurrenzlos günstig Hochtechnologie anbieten. Die wichtigsten Importe der EU aus China sind Informations- und Kommunikationstechnologien und elektrische Anlagen. Seit drei Jahren verdrängt China daher rasant europäische Firmen von den globalen Märkten.
Ein ebenso wichtiger Grund für die fehlende Nachfrage ist der Sparkurs der FDP unter Finanzminister Lindner, der 2023 die Energiekrise für beendet erklärte und auf die Einhaltung der Schuldenbremse drängte. Mit der Entscheidung gegen antizyklische Wirtschaftspolitik beschleunigte er den Verfall der Industrieproduktion, die bereits Ende 2017 ihren Zenit überschritt. Kein Wunder also, dass deutsche Unternehmen in Umfragen angeben, dass die fehlende Nachfrage der wichtigste Faktor ist, der das Geschäft belastet, weit vor dem Fachkräftemangel oder Bürokratie.
Seitdem hat ein negativer Kreislauf eingesetzt, wo das verarbeitende Gewerbe die Arbeitnehmer in Kurzarbeit schickt oder betriebsbedingt kündigt, was wiederum die Nachfrage weiter schwächt. Die Aussichten auf den Exportmärkten sind weiter düster, da der US-Präsident Trump, ein erklärter Gegner des deutschen Exportmodells, pauschale Zölle von 20-60 Prozent gegen den Rest der Welt angekündigt hat. Dazu kommt die politische Unsicherheit, da viele Förderprogramme abgesetzt oder nicht weiter verlängert worden sind. Obwohl damit die Konjunktur insgesamt stark belastet wurde, ist die halbwegs stabile Arbeitslosenquote einem robusten Dienstleistungssektor zu verdanken.
Die Leitlinien
Wie reagieren nun die Parteien auf die Krise des deutschen Exportmodells? Weitgehender Konsens herrscht bei der Einschätzung der Dringlichkeit der Lage. Entsprechend viel Platz und hohe Priorität wird der wirtschaftlichen Entwicklung in allen Parteiprogrammen beigemessen. Die Beurteilung der Ursachen und möglicher Lösungen hingegen verläuft entlang der Lager Rechts gegen Links. Erstere machen fast ausschließlich angebotsseitige, strukturelle Ursachen für die Stagnation aus, während letztere eher nachfrageseitige, konjunkturelle Faktoren in den Blick nehmen.
Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:
Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login