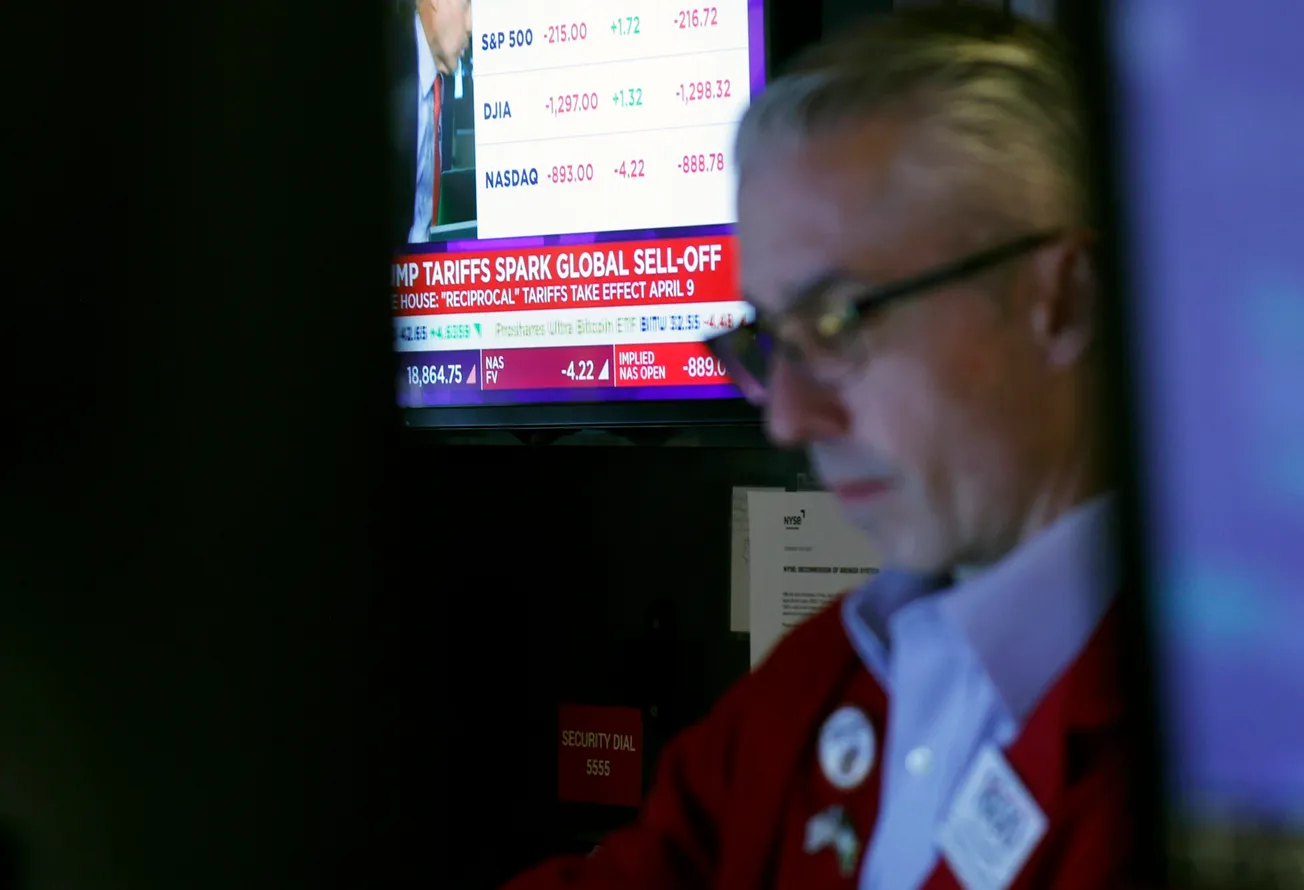Der Koalitionsvertrag ist ein Kompromiss, der unter hohem Druck auf eine schnelle Einigung zustande kam. Er enthält zahlreiche Ungenauigkeiten und bietet so jede Menge Sprengstoff für die kommende Legislatur. Viele der wichtigsten Maßnahmen, wie beispielsweise die Erhöhung des Mindestlohns, sind bewusst unpräzise gehalten. In manchen Fällen wurden die Präferenzen beider Parteien aufgenommen, ohne vermittelt zu werden. Darüber hinaus finden sich auch offene Widersprüche. Schauen wir uns die drei eklatantesten an.
Der erste Widerspruch: Privates Kapital und günstige Energiepreise
Energiepreise werden eines der wichtigsten Themen sein, das die neue Regierung adressieren muss. Sofern die Klimaneutralität 2045 erreicht werden soll, wird es dafür eine erhebliche Beschleunigung des Netzausbaus brauchen. Zur Finanzierung heißt es im Koalitionsvertrag dazu: »Zur Vergabe von Eigen- und Fremdkapital bei Investitionen wollen wir im Zusammenspiel von öffentlichen Garantien und privatem Kapital einen Investitionsfonds für die Energieinfrastruktur auflegen.«
Das Problem ist, dass dies ein Widerspruch ist. Günstige Strompreise wird es nämlich nur geben, wenn die öffentliche Hand den Netzausbau mit öffentlichem Eigenkapital finanziert. Privates Eigenkapital in einem Bereich, in dem es keinen Wettbewerb gibt, wird richtig teuer. Die Renditen auf privates Kapital in der Infrastruktur belaufen sich im Schnitt auf mehr als 10 Prozent – und die Lobbyverbände aus der Finanz- und Energiewirtschaft trommeln deshalb dafür, dass der Regulierer (Bundesnetzagentur) die Eigenkapitalzinsen erhöht, um »privates Kapital zu mobilisieren«. Vor allem (aber nicht nur) in der Union dürften sie auf offene Türen und Ohren stoßen.
Die höheren Renditen der Netzbetreiber werden in der Folge die Haushalte und Unternehmen bezahlen müssen – statt eines Anstiegs der Netzentgelte um 1,7 ct/kWh fällt der Anstieg um nahezu das Doppelte an: 3 ct/kWh. Wie Tom Krebs und ich in einer noch nicht erschienenen Studie darlegen, beläuft sich der direkte Schaden für die Volkswirtschaft bis 2037 auf 110 Milliarden Euro. Der gesamtwirtschaftliche Schaden beträgt sogar das Doppelte, nämlich 220 Milliarden Euro.
Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:
Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login