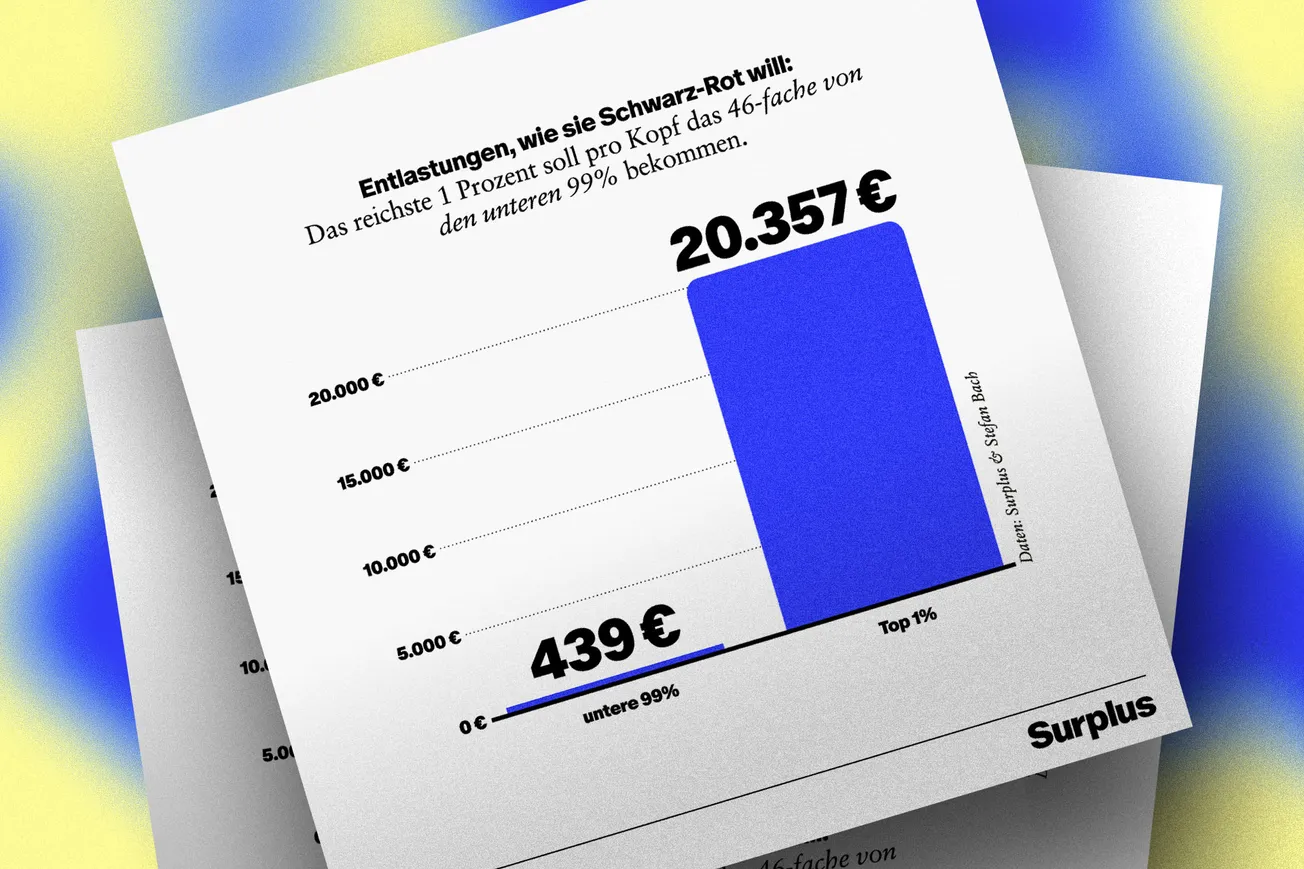In der SPD endet der Mitgliederentscheid zum Koalitionsvertrag. Dass er durchgehen wird, ist wahrscheinlich. Doch wie überzeugt sind die Sozialdemokraten inhaltlich von dem, was die neue Bundesregierung vorhat? In den Diskussionen der vergangenen Wochen haben die Parteivorsitzenden und Abgeordneten tapfer darauf hingewiesen, dass der Koalitionsvertrag zwar nicht perfekt, aber dennoch sozialdemokratisch genug sei, um ihm zuzustimmen. Mit einem Wahlergebnis von 16 Prozent könne man nicht mehr erwarten. Auch weite Teile der Presse bewerten den Koalitionsvertrag als sozialdemokratisch geprägt.
Zusätzlich zu den inhaltlichen Argumenten werden häufig Drohszenarien aufgezeichnet, um für Zustimmung zu werben. Die AfD sei derzeit die stärkste Kraft in den Umfragen, da müsse man sich staatstragend geben. Schwarzrot sei die letzte Chance für die demokratischen Parteien der Mitte, »die letzte Patrone der Demokratie« (Söder) und so weiter. Je länger der Mitgliederentscheid andauerte, desto mehr verfestigte sich der Eindruck, dass Angst und das Gefühl der Alternativlosigkeit über alle inhaltlichen Bedenken hinweggehen. »Wenn ihr nicht zustimmt, dann…« war viel öfter zu hören als »ihr solltet zustimmen, weil…«. Das klingt mehr nach Erpressung als nach einer freien Wahl, was allerdings wenig verwunderlich ist, denn die »Verhandlungserfolge« der SPD sind bei genauerer Betrachtung doch eher blass. Berücksichtigt man zudem die strukturell-politische Grundausrichtung, die die Union aufbaut, manövriert sich die SPD mit der Zustimmung zu diesem Koalitionsvertrag in eine Lage, in der sie kaum eine andere Möglichkeit haben wird, als beim Rechtsruck in diesem Land mitzumachen – was letztlich den Unmut über die Sozialdemokratie und deren Bedeutungsverlust verstärken wird.
Erster Erfolg: Sondervermögen
Als einer der wichtigsten Verhandlungserfolge wird das neue Sondervermögen und die Reform der Schuldenbremse hervorgehoben. Noch mit den Mehrheiten des alten Bundestags wurde ein 500 Milliarden Euro schweres Sondervermögen über 12 Jahre eingeführt, wovon 100 Milliarden an die Länder und 100 Milliarden an den Klima- und Transformationsfonds (KTF) gehen. Hinzu kam eine Reform der Schuldenbremse, die den Ländern etwas mehr Spielräume gibt (0,35 Prozent des BIP) und Verteidigungsausgaben von mehr als 1 Prozent des BIP von der Schuldenbremse ausnimmt. Es wurde als genialer Coup präsentiert, ein großes Zugeständnis der Union an die SPD.
Es stimmt, dass die getroffenen Regelungen der Regierung mehr Handlungsspielräume geben – und das ist zunächst positiv. Allerdings war es kein Zugeständnis an die Union, sondern ein Eingeständnis derselben, dass man einen Wahlkampf auf Basis von Lügen geführt hat. Ohne das Sondervermögen und die Reform – das wussten die meisten Konservativen – wären keine Gestaltungsspielräume vorhanden gewesen. Wie erfolgreich eine Regierung angesichts der Herausforderungen arbeiten kann, wenn sie sich finanzpolitisch die Hände bindet, das hat die Ampel auf eindrucksvolle Weise gezeigt. Für die kommende Legislatur schuf man sich damit mehr Luft, die jedoch unabhängig vom Koalitionsvertrag im Grundgesetz verankert wurde.
Abgesehen von diesen grundsätzlichen Überlegungen ist die Zahl von 500 Milliarden – so eindrucksvoll sie auf den ersten Blick erscheinen mag – bei einer Laufzeit von 12 Jahren alles andere als beeindruckend. Die 42 Milliarden an zusätzlichen öffentlichen Investitionen, die sich daraus ergeben, liegen deutlich unter der Schwelle der 60 Milliarden, die das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) für die kommenden 10 Jahre konservativ geschätzt haben. Investitionen in den Netzausbau beispielsweise, die sich bis 2037 ungefähr auf 37 Milliarden Euro pro Jahr belaufen, wurden dort nicht mit einbezogen, weil dies dem Privatsektor zugerechnet wurde. Auch die 16 Milliarden an zusätzlichen Mitteln für die Länder sind nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.
So sehr man von daher in der politisch-medialen Gemengelage von einem Erfolg sprechen kann – angesichts der Investitionsbedarfe, die für eine Modernisierung der Wirtschaft notwendig sind, bleiben die zusätzlichen Spielräume auf mittlere bis lange Sicht unzureichend. In einigen Jahren werden wir in der Debatte deshalb wieder dort stehen, wo wir vor der Reform der Schuldenbremse und vor dem 500-Milliarden-Sondervermögen standen. Ob und inwiefern es eine nachhaltig wirksame Reform der Schuldenbremse geben wird, steht in den Sternen. Eine Kommission soll hierzu Ergebnisse liefern – und je nach Besetzung dieser Kommission könnte es bei weiteren Reförmchen bleiben.
Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:
Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login