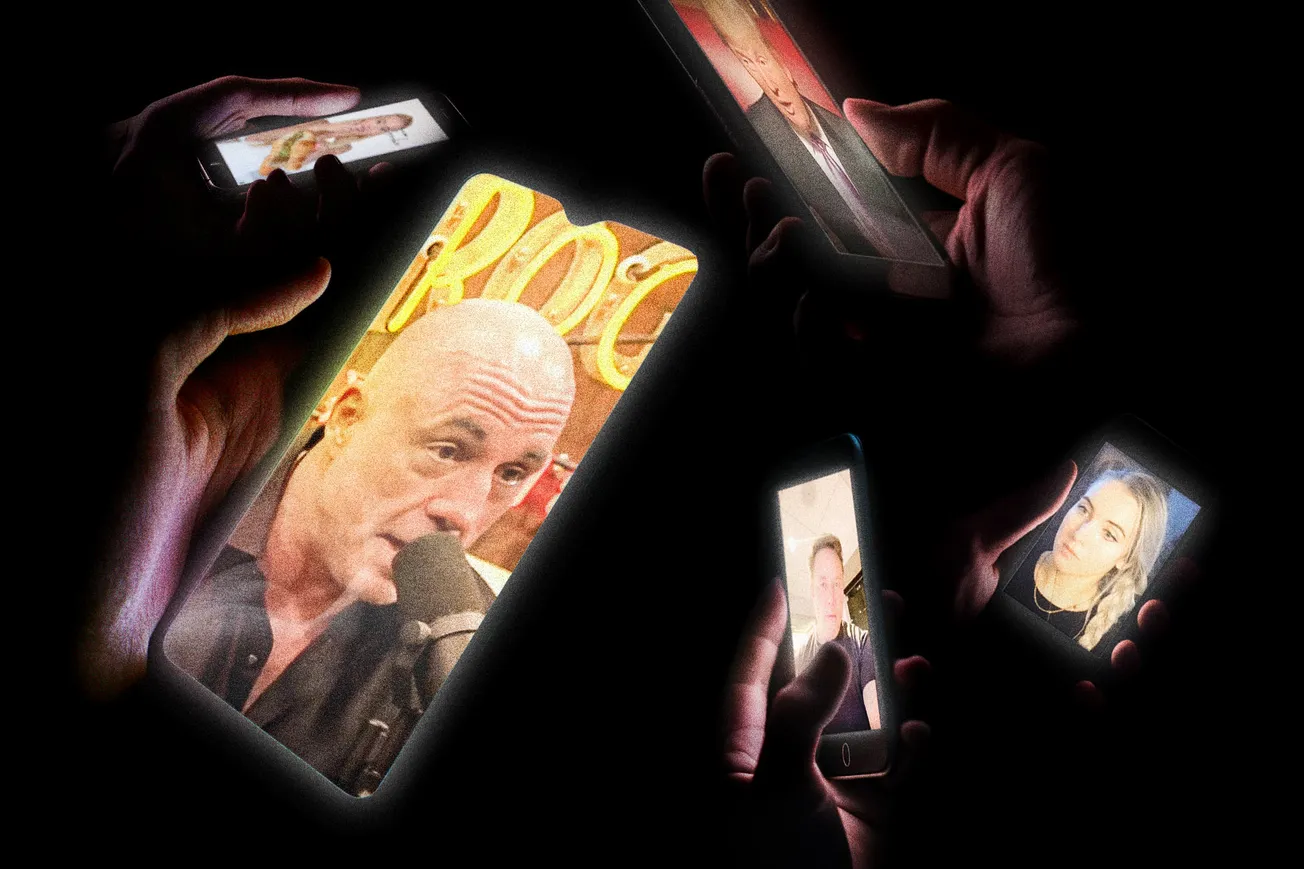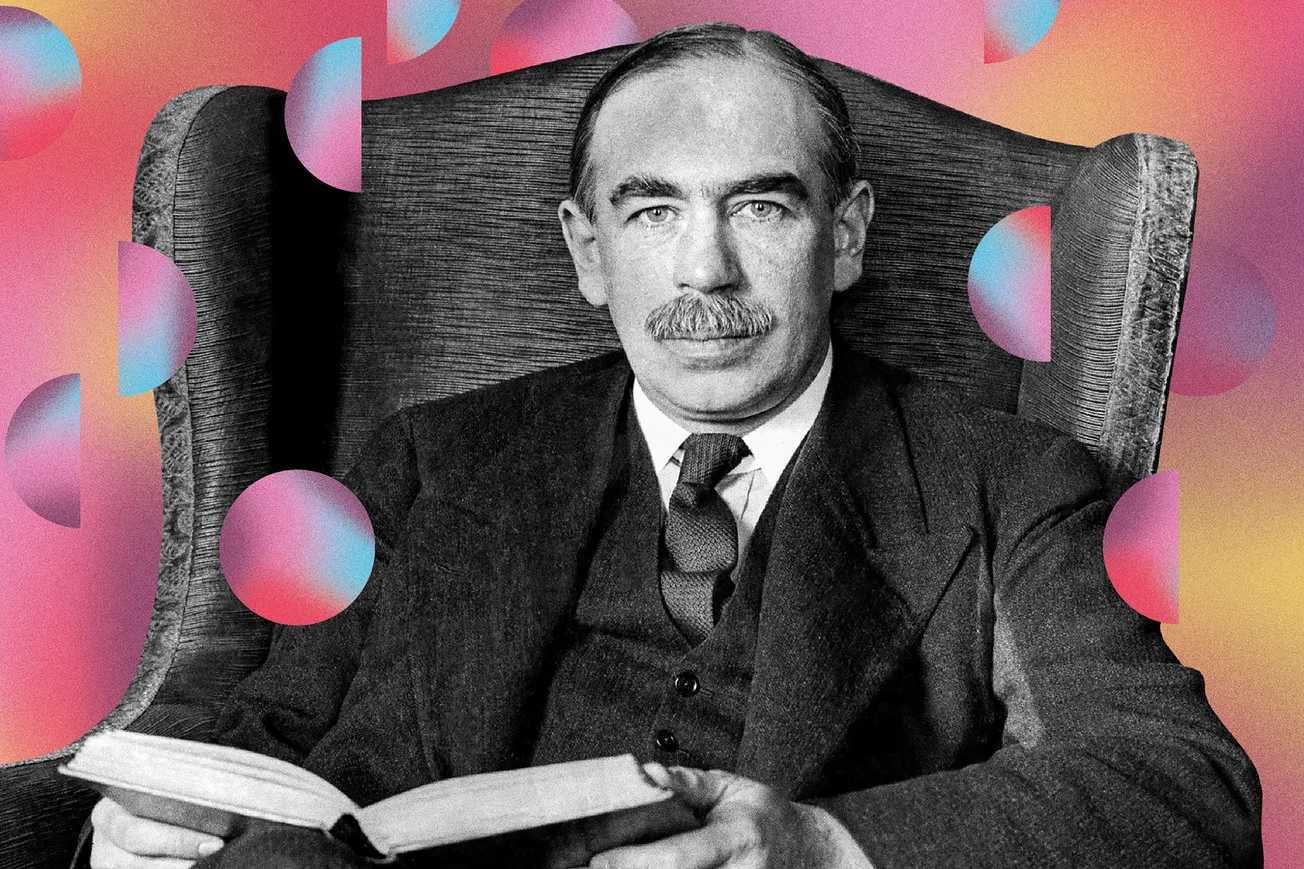In der deutschen Wirtschaftspolitik hält sich ein Mythos hartnäckiger als der Glaube an den Weihnachtsmann: die sogenannte Trickle-Down-Theorie. Sie besagt: Wenn es den Reichen gut geht, dann tröpfelt der Wohlstand nach unten, also zur breiten Masse. Steuersenkungen, Deregulierung oder Erleichterungen für Konzerne helfen aus dieser Sicht also nicht nur den Reichsten. Was im Englischen halbwegs elegant klingt, ist im Deutschen schnell entzaubert: Trickle-Down heißt nichts anderes als »Heruntertropfen«. Und genau so fühlt sich diese Politik auch an – wie der Versuch, den Durst Arbeiterklasse mit einem undichten Wasserhahn zu stillen.
Was auffällt: Das Konzept wird selten offen benannt, aber umso öfter praktiziert. Ob Donald Trump in den USA oder Friedrich Merz hierzulande: Man spricht lieber von »Wettbewerbsfähigkeit« und »Entlastung für Leistungsträger«. Dahinter steckt aber nichts anderes als Trickle-Down-Ökonomie: Steuersenkungen für Besserverdienende sollen Investitionen ankurbeln und damit auch Jobs und Wohlstand für alle schaffen.
Doch das Gegenteil ist der Fall, denn was oben ankommt, bleibt auch dort. Seit Jahrzehnten geht die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland weiter auseinander. Die letzten größeren Reformen haben Spitzenverdiener und Unternehmen entlastet, Betriebsvermögen bei der Erbschaftsteuer privilegiert, aber Einkäufe mit der Mehrwertsteuer und Mobilität mit der Co2-Bepreisung verteuert. Das Ergebnis: Die reichsten zehn Prozent besitzen mittlerweile mehr als 60 Prozent des Nettovermögens und verdienen ein Drittel aller Einkommen. Die untere Hälfte hingegen besitzt kaum etwas – und rackert sich für Niedriglöhne in prekären Arbeitsbedingungen ab.
Trickle-Down ist ein Mythos
Ein besonders absurdes Beispiel aus dem Wahlkampf war der Vorschlag, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen und den Spitzensteuersatz erst ab 80.000 Euro greifen zu lassen – eine vermeintliche »Entlastung der Mitte und der Unternehmer«, wie es die CDU nennt. Faktisch profitieren davon aber vor allem die oberen zehn Prozent, denn das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen liegt in Deutschland bei etwa 45.000 Euro und den Soli zahlen – grob gerechnet – nur die Arbeitnehmer, die mehr als 73.000 Euro Jahresbrutto verdienen. Die »Mitte«, das sind Lehrerinnen, Pflegekräfte, Angestellte – Menschen, die sich nicht mit Aktienoptionen absichern können. Für sie bedeutet Trickle-Down nur eines: Warten auf einen Geldregen, der nie kommt.