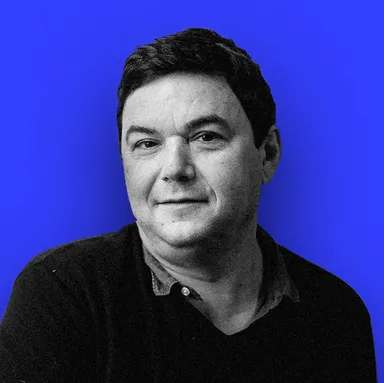Im Frühjahr 1924 kämpfte die deutsche Linke um die Umverteilung des Vermögens der Hohenzollern. Die Herrscherfamilie hatte nach der Abdankung Wilhelms II. und nach der Gründung der Weimarer Republik im Jahr 1919 ihre Macht verloren. Diese unbekannte Episode ist reich an Lehren für die heutige Zeit. Sie veranschaulicht die Fähigkeit der Eliten, die Sprache des Rechts zu nutzen, um ihre Privilegien zu bewahren – und damit gegen die kollektiven Bedürfnisse zu handeln: Gestern der Wiederaufbau des vom Ersten Weltkriegs verwüsteten Europas, heute die Bearbeitung der neuen sozialen und klimatischen Krisen.
Die Weimarer Verfassung von 1919 gilt als eine der fortschrittlichsten ihrer Zeit, besonders in sozialer und demokratischer Hinsicht. Wie das Grundgesetz von 1949 enthält sie eine innovative Definition von Eigentum als sozialem Recht und steht im Gegensatz zu einem strikt individuellem und unbegrenztem Recht, das von den materiellen Bedürfnissen betroffener sozialer Gruppen absieht. Der Verfassungstext von 1919 legt fest, dass das Gesetz den Immobilienbesitz und die Verteilung von Grundstücken an soziale Ziele knüpft, wie zum Beispiel die Gewährleistung »gesunder Wohnverhältnisse für alle deutschen Familien« und »Wohn- und Arbeitsstätten, die ihren Bedürfnissen entsprechen« (Artikel 155). Die Regierung verabschiedete die Verfassung vor dem Hintergrund eines drohenden Aufstands, sie ermöglichte eine umfassende Landumverteilung und begründete neue soziale und gewerkschaftliche Rechte.
Auch das deutsche Grundgesetz von 1949 bekräftigt, dass Eigentumsrechte legitim sind, wenn sie »dem Gemeinwohl dienen« (Artikel 14). Die Verfassung betont, dass die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und die Neudefinition von Eigentumsrechten gesetzlich gestaltet werden können (Artikel 15). Der Artikel ermöglicht strukturelle Reformen und demokratische Kontrolle des Eigentums. Das von Gewerkschaften erkämpfte Mitbestimmungsgesetz von 1951 legte fest, dass Arbeitnehmervertreter 50 Prozent der Sitze in den Aufsichtsräten der großen Stahl- und Kohleunternehmen erhielten. Die Gesetzesreform von 1952 weitete die Mitbestimmung auf alle Gewerbezweige aus. Die Reform von 1976 führte das aktuelle System ein, bei dem ein Drittel der Sitze für Arbeiterinnen und Arbeitern in Unternehmen mit 500 bis 2000 Beschäftigten – und die Hälfte der Sitze in Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten vorgesehen sind.