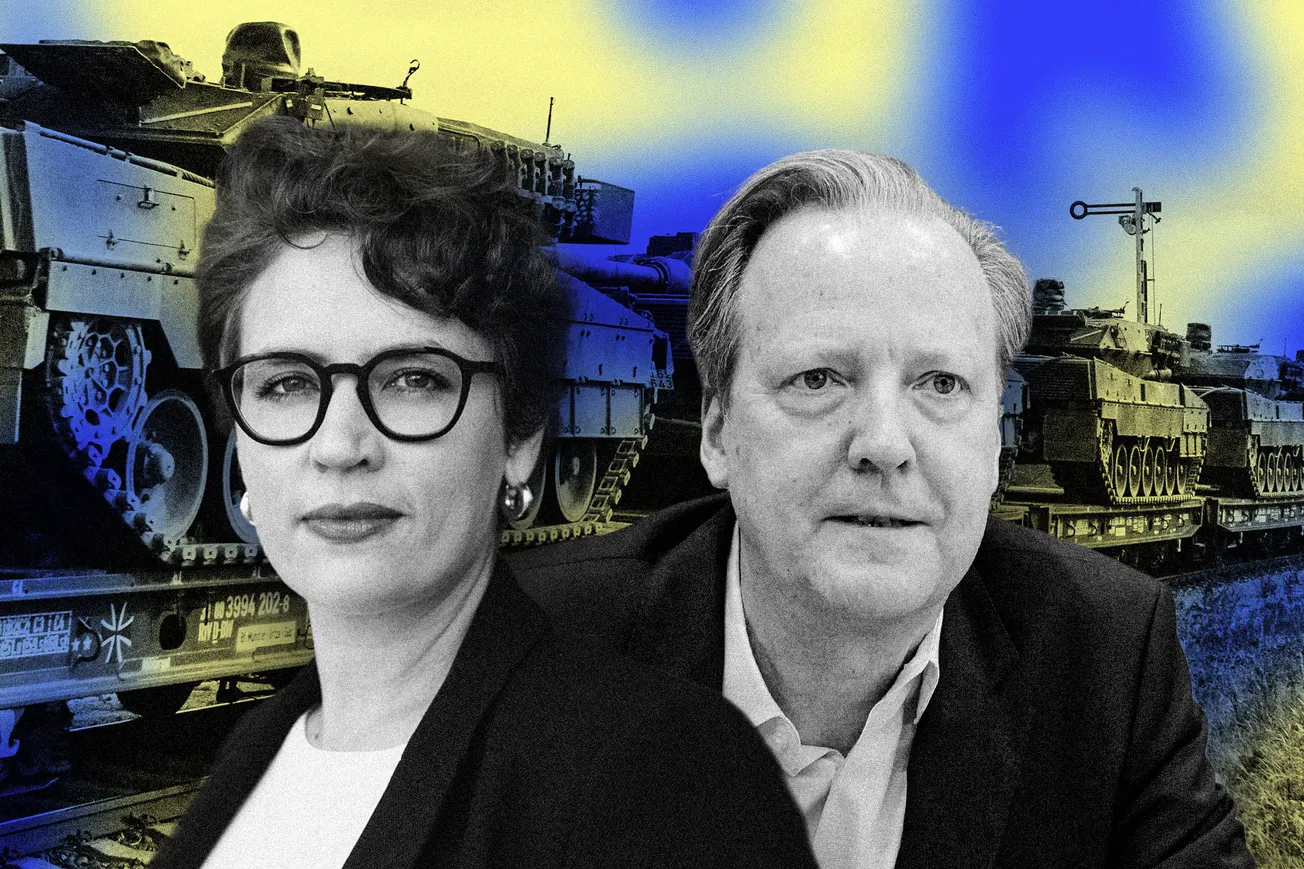In der öffentlichen Debatte in Deutschland werden seit einigen Jahren – so zuletzt auch im Bundestagswahlkampf 2025 – kontroverse Positionen zum Thema Arbeitszeit diskutiert. Die einen forderten allgemein kürzere (bezahlte) Arbeitszeiten mit dem Ziel einer verbesserten Work-Life-Balance und einer gleichmäßigeren Verteilung unbezahlter Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen. Andere plädierten hingegen für eine Kultur längerer Arbeitszeiten vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und des vergleichsweise niedrigen Wirtschaftswachstums in Deutschland. Zusätzlich wurden innovative Ideen zur kollektiven Arbeitszeitgestaltung diskutiert, so etwa die Einführung einer sozialen Dienstzeit oder eine neue Wehrpflicht.
Seit der Bundestagswahl und in den laufenden Koalitionsverhandlungen scheint die Sichtweise, dass in Deutschland mehr gearbeitet werden muss, an Einfluss gewonnen zu haben. Konkret sind unter anderem die Steuerbefreiung von Überstundenzuschlägen, die Abschaffung eines arbeitsfreien Feiertages und Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitszeiten von Frauen im Gespräch. Dabei wünschen sich die Beschäftigten in Deutschland seit Jahren eher kürzere als längere individuelle Arbeitszeiten, auch um den Preis geringerer Verdienste. Auch die Idee der 4-Tage-Arbeitswoche als neue Norm für eine kürzere Vollzeitbeschäftigung ist überaus beliebt. Dies zeigt eine repräsentative Beschäftigtenbefragung, die Jan Behringer, Zarah Westrich und ich im Herbst 2024 zu individuellen Arbeitszeitwünschen und zur Zustimmung zu verschiedenen arbeitszeitpolitischen Reformoptionen durchgeführt haben. Eine Politik, die sich an den Bedürfnissen der Beschäftigten orientiert, darf dies nicht außer Acht lassen.
Zur Versachlichung der Arbeitszeitdebatte ist zunächst ein Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Zahlen hilfreich. Das Arbeitsvolumen pro Kopf der Bevölkerung ist seit der Wiedervereinigung vor 30 Jahren in etwa konstant, es gab also keine gesellschaftliche Arbeitszeitverkürzung. Zugleich ist die Erwerbstätigkeit um etwa 7 Millionen Personen gestiegen, vor allem aufgrund der gestiegenen Erwerbstätigkeit bei Frauen, die im Durchschnitt mit kürzeren Wochenarbeitszeiten arbeiten als Männer, und aufgrund der Zunahme der geringfügigen Beschäftigung. Entsprechend ist die jährliche Arbeitszeit pro erwerbstätiger Person gesunken. In diesem Zusammenhang warf Friedrich Merz, der Kanzlerkandidat der CDU/CSU, im Wahlkampf die Frage auf, ob die Bürgerinnen und Bürger nicht künftig mehr Arbeitsstunden leisten sollten: »Wenn wir sagen, es ist ein Stück unserer Lebenserfüllung, ein Stück unserer Selbstverwirklichung, wir haben sogar vielleicht Freude an unserer Arbeit, dann können wir doch mal vorurteilsfrei die Frage stellen: Warum leisten wir heute eigentlich mit 45 Millionen Erwerbstätigen nicht mehr Arbeitsstunden als vor 30 Jahren? Da hatten wir sieben Millionen Erwerbstätige weniger.«
Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:
Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login