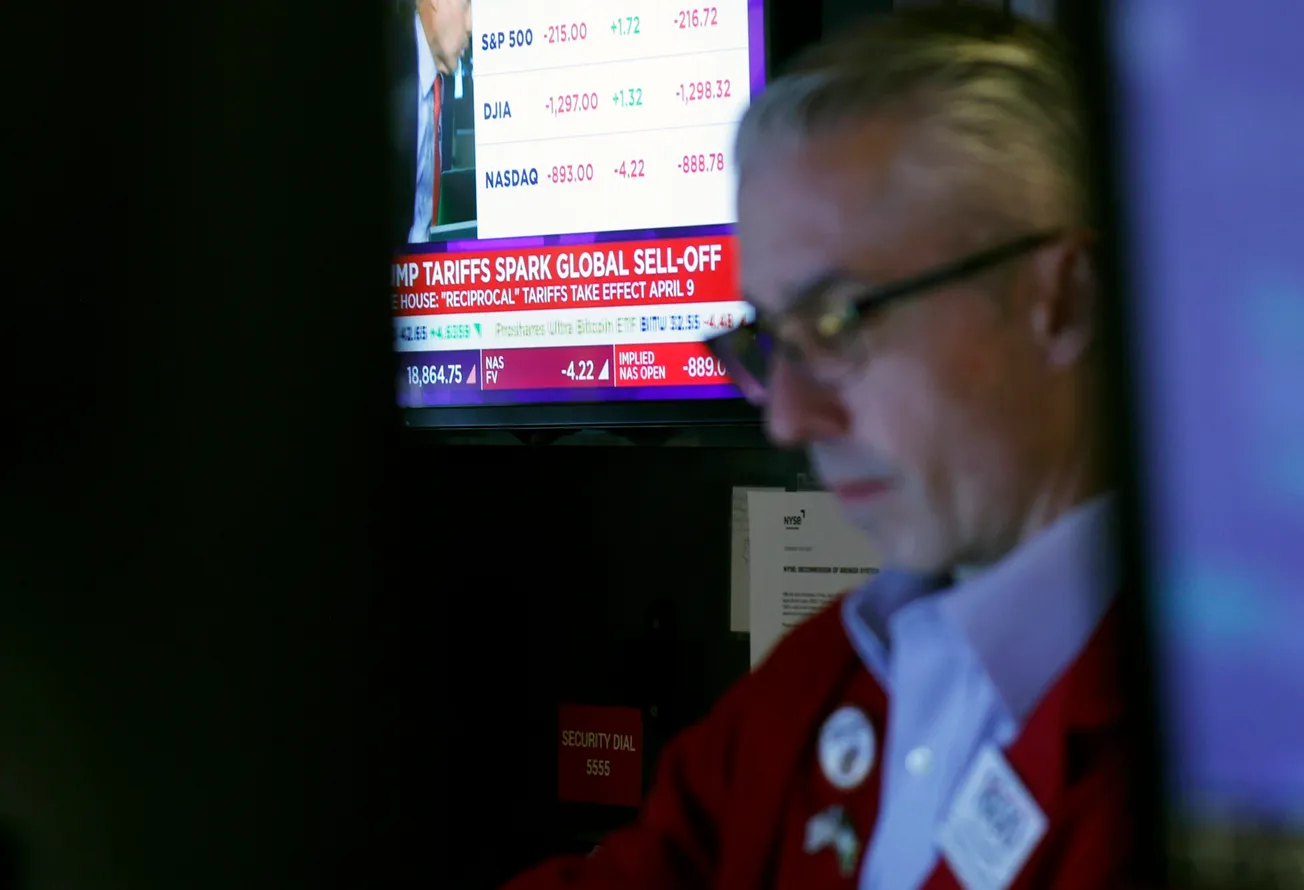Angesichts der von der Trump-Administration weltweit verhängten »verrückten« Zölle äußern sich viele Kommentatoren besorgt hinsichtlich des Problems des sogenannten »Sane-Washings«: Dabei werden politischen Maßnahmen, für die es keinerlei rationale Begründungen gibt, dennoch solche zugeschrieben. Derartig naive Expertisen lenken von dem Schwindel ab, der sich vor unseren Augen abspielt, so die Argumentation. Die Vorstöße der Familie Trump in die Krypto-Sphäre – wo ihre Meme-Coins als offene Einladung für Bestechungsgelder dienen – stützen diese Interpretation zweifellos. Aber ist das die einzige Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, oder könnte auch etwas anderes dahinterstecken?
Das amerikanische Projekt zur Förderung des globalen Freihandels war bereits zum Zeitpunkt der Wahl 2016 aufgegeben worden, als sich sowohl Donald Trump als auch Hillary Clinton im Wahlkampf gegen die Transpazifische Partnerschaft (TPP) aussprachen. Trump führte daraufhin Zölle auf Waren aus China und anderen Ländern ein, von denen viele unter Präsident Joe Biden beibehalten oder ausgeweitet wurden. Eine der wichtigsten politischen Maßnahmen Bidens war der Inflation Reduction Act. Dieser war ein Versuch, die Reindustrialisierung der USA in grünen Sektoren zu fördern, die nicht nur durch Trumps Zölle geschützt, sondern auch subventioniert werden sollten. Trumps jüngste Welle an Zöllen soll ebenfalls die Reindustrialisierung vorantreiben, wenn auch in einer CO2-intensiveren Variante. Der Freihandel scheint also sowohl für Republikaner als auch für Demokraten passé zu sein.
Der Grund für diese parteiübergreifende Hinwendung zu protektionistischen Maßnahmen liegt in der globalen Rolle des Dollars bei der Begünstigung struktureller Handelsungleichgewichte. Wie John Maynard Keynes bereits 1944 erkannte, wären alle Länder, wenn man sie sich selbst überließe, lieber Nettoexporteure als Nettoimporteure. Die heutigen Nettoexporteure in der Europäischen Union, in Asien und in der Golfregion verdienen Dollars, die ihre eigenen Volkswirtschaften nicht absorbieren können, weil dies eine Erhöhung der inländischen Löhne und Preise zur Folge hätte. Das wiederum würde ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Die verdienten Dollars sind für die lokalen Banken Verbindlichkeiten. Der einfachste Weg, sie in Vermögenswerte umzuwandeln, besteht darin, US-Staatsanleihen zu kaufen – und das Geld so effektiv an die Vereinigten Staaten zurückzugeben, damit diese weiterhin Exporte bezahlen können.
Auf diese Weise haben die USA in den letzten 40 Jahren so ziemlich alles importiert, was sie wollten. Sie gaben mit 2 Prozent verzinste digitale Schuldtitel aus, die nie eingelöst wurden, da US-Schatzanweisungen für Exporteure das bevorzugte Anlageinstrument sind. Dies bedeutet unter anderem, dass die USA keinen Einschränkungen hinsichtlich ihrer Leistungsbilanz unterliegen.
Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:
Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login